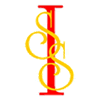Eigentlich sollte im Deutschunterricht bereits Achtsamkeit auf Wortwahl nicht mit dem Ziel poetischer Ästhetik vermittelt werden – ich hoffe, diese Herausforderung gilt noch? – sondern vor allem auf die Wirkkraft von Autosuggestionen. So lese ich etwa im heutigen Kurier auf Seite 31 (Artikel „Wie Hypnose das Sexleben verbessert“) den Satz: „Einsam nur zu masturbieren, das macht zwar satt, schadet aber dem Appetit auf einen realen Partner“. Und dann sagt die interviewte Ärztin und Hypnose-Psychotherapeutin: „So wie beim gierigen Runterschlingen einer Speise wird viel konsumiert, es macht aber nicht glücklich“.
Nun stimmt es schon nicht, dass Masturbation satt macht – außer man verwendet das Wort „satt“ im Doppelsinn von „angespeist“. Und wenn man eine Speise runterschlingt, heißt das noch lange nicht, dass es gierig geschieht und auch, dass es viel sein wird: Essgewohnheiten werden oft schon im Elternhaus geprägt, beispielsweise wenn immer Zeitdruck vermittelt wird, egal aus welchen Gründen, und es nie die ausgleichende Balance z. B. eines Buffets gibt, das nicht gleich abgeräumt wird und von dem man sich immer wieder nachnehmen kann.
Es kennt vermutlich jeder Mensch Situationen, wo einem mitten im Essen der Appetit vergeht, und zwar ohne, dass man Sattheit verspürt. Ähnliches findet oft dann statt, wenn es während eines Aktes keine seelische Verbindung gibt und die Gedanken der einen Person woandershin abirren und die andere Person das spürt – wenn sie sensibel genug ist. Viele sind das nicht, besonders wenn sie nur „konsumieren“ wollen. Und genau das ist das Problem: Appetit auf jemand zu haben, reduziert diese Person auf eine Ware, die man sich „einverleibt“.
Solch eine Formulierung macht die Gesinnung deutlich: Man ist nicht an der Person interessiert, sondern nur am eigenen Lustgewinn.
Von dem deutsch-amerikanischen Soziologen und Psychoanalytiker Erich Fromm stammen – unter vielen – drei Bücher, die man gelesen haben sollte. Zwei wurden weltberühmt: „Die Kunst des Liebens“ und „Haben oder Sein“. Das dritte aber ist das wichtigste, aber auch unangenehmste: „Anatomie der menschlichen Destruktivität“. Darin zeigt Fromm auf, wie sehr sich der moderne, technik-gläubige Mensch unbewusst von Gefühlen entfernt – seinen eigenen wie denen anderer, oder auch bewusst „distanziert“. Statt langsam schauend zu „er-leben“ wird etwa schnell fotografiert, denn dann „hat“ man ein Foto, „auf Dauer“, wie man wähnt.
Haben-Menschen „haben Sex“ statt sich in Einheit mit einem Menschen zu „er-leben“, egal wie. Das „wie“ ist immer das Leben, wie es „ist“ – nicht wie es sein „soll“.
Aber Anleitungen, „wie man es macht“, damit man es dann „hat“, wie es sein „soll“, verkaufen sich halt gut – weil man uns von klein auf eingeredet hat, dass wir nur brav einer „Norm“ entsprechen müssen – die uns andere vorgeben – damit wir von denen anerkannt und belobigt werden.
Es braucht halt dann Zeit, bis wir das darin verborgene Unterwerfungs-Gebot erkennen.