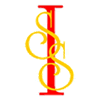Rotraud A. Perner
ALTER UND POTENZIALE – ein Widerspruch?
„Positionstext Dr. Rotraud A. Perner im Dialog mit DDr. Michael Landau am 9. Mai 2019 in der Denkwerkstatt St. Lambrecht“
„Es war einmal …“ Es war einmal eine Zeit, in der „die Alten“ geschätzt wurden, denn damals wussten die wenigsten zu schreiben oder zu lesen[1], von Internet und Suchmaschinen war noch lange keine Idee geschweigedenn Rede, daher war man auf das tradierte Wissen angewiesen, und das hatten (außer Priestern bzw. Schamanen[2]) die Alten – und auch die Zeit zum Erzählen. Sie waren lebende Lexika, wussten vielerlei Rezepte und Abhilfen und – sie waren damit Vorbilder für Unterstützung.
Heute wissen wir dank der computergestützten Gehirnforschung, dass und wie wir „in Beziehung“ lernen: wenn wir zusehen, werden die gleichen Gehirnareale aktiviert wie bei der beobachteten Person – egal, ob wir sie live erleben oder auf einem Bildschirm[3]. Hermann Meier hat so nach seinem schweren Motorradunfall bewusst seine sportlichen Fähigkeiten „mental“ trainiert. Viele Jugendliche trainieren hingegen durch zu viel Konsum von Action- oder Kriminalfilmen wie auch Videospielen unbewusst Gewalt oder kriminelle Potenziale. Zu diesen kriminellen Potenzialen gehört Gewalt gegen Schwächere – und dazu zählen meist Jüngere wie auch Ältere.
Heute meinen viele Junge, auf unterstützende Beziehungen verzichten zu können: was zum Essen gibt es in Automaten, darüber hinausgehenden Notbedarf an 24-h-geöffneten Tankstellen, und Weisheit holt man sich von Dr. Google. Und für das, was Unwissende für Liebe halten, gibt es aufblasbare Puppen und Dildos. Leben wird damit auf sprach-, beziehungs- und empfindungslose Schnellbefriedigung von Mangelimpulsen – vor allem Energiemangel – reduziert. Leben als sinnen-voller Genuß von anhaltenden äußeren und inneren Sensitivitäten wie es Kinder noch praktizieren bevor sie auf Erfolg trainiert werden, verkümmert – wenn niemand da ist, der ihnen diese Form von Achtsamkeit vormacht. Im sogenannten Alter ist es ebenso.
Wir lernen – d. h. wir bilden Wahrnehmungs- oder Handlungsnervenzellen – durch Imitation von Vorbildern.
Meisterschaft – „Können“ – erwerben wir durch Übung und Unterstützung, Motivation durch Zuwendung und Anerkennung. Das ist eine wichtige Aufgabe für Ältere, Erfahrenere und Förderbereite … jedoch: Zum Fördern bereit ist man dann, wenn man sich selbst wertgeschätzt fühlt. Wertschätzung erfordert Begegnung auf Augenhöhe – nicht aber destruktive Konkurrenz und diese womöglich noch mit Methoden der „psychologischen Kriegsführung“ wie Abwerten, Verhöhnen, Beschämen bis zum Ausgrenzen und Wegsperren.
Beobachtet man den Verlauf solcher individuellen wie auch kollektiven „Mobbing“-Inszenierungen weit über die Konkurrenz der Nähe (z. B. am Arbeitsplatz) hinaus, zeigt sich meist Angst um die eigene – materielle wie soziale – Existenz, und zusätzlich, wie diese aggressiv-sadistische Impulse anwachsen und schlussendlich chronisch werden läßt … außer es wird diesem Verlauf energisch und dabei doch wertschätzend für die jeweilige Person, sich selbst mitgemeint, widersprochen.
Wir alle brauchen wertschätzende Gemeinschaften
– und dazu brauchen wir Vorbilder.
Die Schweizer Psychoanalytikerin Alice Miller (1923 – 2010) wurde nicht müde zu betonen: „Wenn man einem Kind Moral predigt, lernt es Moral predigen, wenn man es warnt, lernt es warnen, wenn man mit ihm schimpft, lernt es schimpfen, wenn man es auslacht, lernt es auslachen, wenn man es demütigt, lernt es demütigen, wenn man seine Seele tötet, lernt es töten. Es hat dann nur die Wahl, ob sich selbst oder die anderen oder beides.“[4]
Wenn wir reflektieren, nach welchen Erziehungsgrundsätzen die Menschen, die heute als alt gelten (old olds: Geburtsjahrgänge ab 1920 bis 1940/ 45, young olds: ab 1945 bis 1960) sozialisiert wurden, merkt man bereits große Verhaltensunterschiede, wenn es gilt, biographischen Veränderungen, insbesondere Krisen und Brüche, zu bewältigen.
Grob kann man feststellen, dass die sogenannten old olds eher zum Ignorieren bzw. Verschweigen von Hilfsbedarf neigen, von sich selbst wie auch von anderen Stärke und Autarkie verlangen und Ursachen für Versagen bei sich selbst suchen. Demgegenüber sind die young olds eher bereit, über ihre Schwächen und Bedürftigkeiten zu reden und Hilfe anzunehmen, oft sogar vehement einzufordern – aus meiner Erfahrung als Wiener Kommunalpolitikerin der Jahre 1973 – 1987 eine Folge der vielfachen Aufforderungen zur Abkehr von devotem Bittstellertum und mehr Selbstbehauptung gegenüber „der Verwaltung“. Diesen damals „neuen“ Stil kann man heute bei den sogenannten „Wutbürgern“ beobachten, solange sie noch genügend Kraft zur Wut ihr Eigen nennen. Was nämlich vor den 1970er Jahren nicht allgemein vermittelt wurde, war theoretische wie praktische Kompetenz zu gewaltverzichtender Nutzung demokratischer Möglichkeiten[5]. Sie blieb Elitewissen; erst in den 1990er Jahren wurde vom Familienministerium Mediation als Fortbildung für BeamtInnen im Sozialbereich angeboten und Jahre später auch als quasi eigenständiger Beruf gelehrt und gesetzlich geregelt. Ins Allgemeinwissen wird dieser Kommunikationsstil noch immer nicht eingespeist, sondern nur von engagierten PädagogInnen demonstriert.
Prävention ist ein Bildungsproblem
Bildung bedeutet auch, zu wissen, „how to do“ den Mut aufzubringen und dann auch auszuhalten, unangenehme Zukunftsbilder gedanklich zuzulassen, in Frage zu stellen und möglichst zu antizipieren. Das lernt man wie bereits angeführt an motivierenden Vorbildern – aber die findet man selten. Was man findet, sind Mahner und Kritisierer (mehrheitlich weiblich) – und so lernt man wiederum nur die Denk- und Sprachformen des Mahnens und Kritisierens.
Wie die Kommunikationswissenschaftlerin Aga Trnka-Kwiecinski in ihrem Text „Inszenierungen“[6] verdeutlicht, liegt hinter dem Klischee Alter ein gesellschaftlicher Konsens, alt sein mit körperlichem und geistigem Verfall gleichzusetzen und Nutzlosigkeit gleichzusetzen und damit als Belastung zu definieren.
In der therapeutischen bzw. beraterischen Praxis habe ich oft von älteren Frauen aus bäuerlichem Milieu die Klage gehört, ihnen würde stets bei nachlassender körperlicher Leistungsfähigkeit das Pauluswort 2 Thess 3, 10 – „Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen“, mit der Verballhornung arbeitet! – entgegengeschleudert.
Aus meiner Sicht hängt diese Stereotypisierung damit zusammen, dass üblicherweise all das verstärkt wahrgenommen (bzw. allenfalls verdrängt) wird, was heftige unerwünschte Gefühle auslöst, und das sind zumeist Bedrohlichkeiten für das eigene Wohlbefinden wie die Tatsachen, dass einem selbst Einsamkeit und Isolation, Krankheit und Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Abhängigkeit, vor allem aber auch Armut widerfahren könnte – oder dass man mit diesen Belastungen anderer konfrontiert und zum persönlichen wie auch finanziellen Beistand herausgefordert ist. Ich sehe das als Folge einer seit Jahrzehnten auf Autarkie hinzielenden Produktwerbung: wenn jedermensch seinen eigenen Fernseher hat, braucht man sich nicht mit anderen über die Programmwahl zu einigen; wenn SMS das Gespräch von Angesicht zu Angesicht ersetzt, erspart man sich auf den Ton zu achten, der bekanntlich die Musik macht; und wenn man selbst mit dem E-Scooter durch die Straßen fegt, braucht man nicht mehr auf Langsamere Rücksicht nehmen, denn bevor die etwas sagen können, ist man schon wieder fort in der Anonymität etc. etc. und die Kluft zum Anderen wird immer größer, weil das eigene Potenzial an Menschlichkeit – sich selbst im durchsetzungsschwächeren, sprachlosen, ängstlichen und leidenden Anderen erkennen zu können – abnimmt.
Das Dilemma der Grenzziehungen
Grenzen werden meist dann gezogen, wenn einem die Hilfsbedürftigkeit, das Leid, die Wut oder die Unverschämtheit anderer Menschen zu nahe kommt.
„Unverschämt“ schreibe ich deshalb, weil generell erwartet wird, dass man sich bei „Bedürftigkeit“ schämen und andere damit nicht belästigen sollte. Besonders bei der Generation der Geburtsjahrgänge, die im Dritten Reich mit dessen hohen Anforderungen an körperlicher Stärke und Ausdauer, Schönheit und Disziplin sozialisiert wurden und die heute zu den „old olds“ zählen, bedeuteten „Defizite“ gegenüber den propagierten Vor-Bildern oft reale Bedrohung, daher suchte man mittels Abgrenzung Vergleichen zuvor zu kommen. Aber auch heute liegt die Angst vor eigenem gesundheitlichen, finanziellen bzw. sozialen Status-Verlust und folgender Isolierung von bisherigen beruflichen und familiären Vernetzungen und letztlich Herausfallen aus der sozialen Gemeinschaft hinter Reaktionsweisen wie gezieltem Nicht-Wahrnehmen, Wegdelegieren an „Institutionen“ oder auch Spott und Hohn.
So habe ich selbst unlängst bei meinem Besuch bei einer ehemaligen Volksschulfreundin erlebt, dass diese, als ich auf ihre Frage, weshalb ich mit nunmehr 75 noch immer weiter arbeite anstatt so wie sie, eine Pflichtschullehrerin, meine Pension zu genießen, antwortete, weil u. a. meine Pension beim Antritt nicht lebenssichernd war (und ich außerdem viel Angebote und Nachfragen hatte, höhnisch bemerkte „Sollen wir jetzt für dich sammeln gehen?“ Offensichtlich war für sie die Ent-Täuschung des Auseinanderfallens ihres Fremdbildes mit der Entblößung meines Selbstbildes nicht akzeptabel, daher musste ich zurechtgewiesen werden. (Wobei tiefenpsychologisch entschlüsselt, in ihrer Reaktion auch die gesamtgesellschaftliche Problemlösung des Beistands enthalten und gleichzeitig abgewehrt war.)
Zu den Grenzziehungen zählt aber auch die Abwehr des Vergleiches zwecks Erhalt der eigenen Selbstgefälligkeit: wie die US-amerikanische Psychologin und Soziologin Betty Friedan (1921 – 2006) im Zuge ihrer Forschungen bereits in den 1980er Jahren herausfand, wurden die verblüffenden Phänomene, dass sich viele Menschen nach Beendigung ihres Erwerbslebens bzw. Frauen auch nach Ende ihrer Familienpflichten ihre Befindlichkeit nicht nur geistig sondern auch körperlich massiv verbesserten, in der Wissenschaft generell ignoriert. Primär wurden pathologische Erscheinungen als „normaler Alterungsprozess“ beforscht – eben aus einem medizinischen Blickwinkel und nicht aus einem soziologischen oder sozialpsychologischen. Erst mit dem Paradigmenwechsel vom Defizitmodell zum salutogenetischen Ressourcenmodell wurde nach den Ursächlichkeiten gefragt, die Menschen bis ins hohe Alter Vitalität und Lebensfreude verschafften – allerdings wieder aus medizinischer Sicht, daher bezogen auf Ernährung und Bewegung. Friedan hingegen schälte aus den Lebensstilen die Anteile Selbstgestaltung und Selbstbestimmung heraus. Sie zeigte damit aber auch, dass paternalistisch gutgemeinte Über-Fürsorge wesentliche Ressourcen hemme und damit einen ignorierten Beitrag zum sogenannten Verfall von Fähigkeiten darstelle[7].
Das Dilemma der Fremdbestimmung
Unter Fremdbestimmung werden üblicherweise gesetzliche oder vertragliche
Über- bzw. Unterordnungen verstanden, die durch „berechtigte“ Personen verkörpert werden. Nicht beachtet wird dabei die Fremdbestimmung durch Propaganda und – Namensgebung; zu dieser gehören nicht nur Zuschreibungen wie Lob und Tadel sondern etwa auch Diagnosen.[8] (Deshalb wird in der personzentrierten Gesprächspsychotherapie nach Carl R. Rogers auch auf psychiatrische Diagnosen verzichtet und stattdessen Aufmerksamkeit subjektiven Empfindungen und deren Plastizität gewidmet.)
Propaganda und Namensgebung bestimmten sublim das Selbstbild und den Lebensstil; so werden durch die immer breitere Lebensbereiche umfassende Kommerzialisierung Menschen zu Konsumenten bestimmt und damit eine Grenzlinie zwischen denen gezogen, die bestimmte Waren und Dienstleistungen konsumieren können und denen, die von diesen Möglichkeiten ausgeschlossen sind. Dass manche Menschen sich diesem Wirkbereich bewusst entziehen, wird dabei ausgeblendet – es wäre ja ein Hinweis auf das Potenzial der Selbstbestimmung. Es könnte Beispiel geben.
Zur Selbstbestimmung zählt auch das eigenhändige Herstellen von Produkten und Gestalten der Lebensumwelt. Kleine Kinder trauen sich das noch zu – bevor ihnen beruflicher oder anderer pflichtbedingter Zeitmangel aber auch gezielte Entmutigung die Lust an der Selbstentwicklung nehmen. Dabei hat wiederum schon Betty Friedan an Hand vieler Beispiele darauf hingewiesen, dass gerade die dritte Lebensphase dazu Zeit und Raum bietet[9]. Allerdings hängt dieser Mut zur Zukunftsvision – wie kurz diese Zukunft auch sein mag[10] – auch damit zusammen, Kritik und soziale Behinderung gelassen zu ertragen, und das hängt davon ab, wie sehr jemand sich liebevoll von Erpressungsversuchen „aus Liebe“ unabhängig machen kann. Bertold Brecht hat das in seiner Erzählung von der „Unwürdigen Greisen“ anschaulich geschildert.
Sich selbst neu erfinden
„Auf neue Weise fruchtbar“ heißt ein Bucht, das sich mit Frauen jenseits ihrer Fortpflanzungsfähigkeit beschäftigt. Dieser Hinweis gilt auch für Männer, die ebenso ihr Leben verändern müssen, wenn wesentliche Momente ihrer Eigendefinition wegfallen. Betty Friedan schreibt, dass sich Männer mit dieser Aufgabe schwerer tun als Frauen.[11] Ich vermute, dass dies daran liegt, dass Frauen meistens im Laufe ihres Lebens ein größeres Unzufriedenheitspotenzial[12] [13]angesammelt haben als diejenigen Männer, die im Gefolge des militärisch ausgerichteten Männerrollenbildes zur Disziplin des angepassten Gehorsams trainiert wurden. Vor allem spüren sie das in ihnen brach liegende Potenzial dann, wenn ihre Kinder erwachsen werden und ihre Zukunftschancen erproben (und sie sich nicht damit zufrieden geben, sie zu den selbst verhinderten Karrieren anzutreiben): dann beginnen viele Frauen neue Berufe zu erlernen, ihr künstlerisches Potenzial zu formen oder sich politisch zu engagieren – aller Kritik zum Trotz.
Die Formulierung „sich selbst neu erfinden“ wird häufig auf Künstler und Künstlerinnen angewandt – beispielsweise Madonna oder Conchita Wurst – und das nicht immer anerkennend, ganz im Gegenteil. Möglicherweise deshalb, weil es Konkurrenzängste oder Unterlegenheitsgefühle auslöst, wenn sich andere etwas trauen, was einem selbst verboten wurde. Es trauen sich ohnedies nur Bildungsprivilegierte und – GrenzgängerInnen.
Karrieren sollen in vorgezeichneten und kontrollierbaren Bahnen verlaufen um anderen nicht „über den Kopf zu wachsen“. Die Freiheit des Alters besteht aber gerade auch darin, sich diese Grenzüberschreitung zu erlauben – und wenn es nur mit Hilfe von Demenz geschehen kann.
Nachtrag vom 1./2. Juni 2019
Anlässlich der Bestellung der ersten österreichischen Bundeskanzlerin titelt DER STANDARD unter „Sichtbar mit siebzig“[14], dass ältere Frauen nicht länger „unsichtbar in der Öffentlichkeit“ seien und verweist bildbelegt auf Nancy Pelosi (78), Maxine Walters (80), Glenn Close (71), Irmgard Griss (73) und eben Brigitte Bierlein (69). Die Reihe wäre fortsetzbar – z. B. mit der US-amerikanischen geschäftstüchtigen Innenarchitektin und Modeikone Iris Apfel (97) oder auch der politisch redefreudigen Schauspielerin und Sängerin Erika Pluhar (80). Was dabei aber vergessen wird: das alles sind bildungsprivilegierte und medial hofierte Frauen der upper class – in die zu gelangen auch wiederum von Bekanntheit abhängt.
Freiwerden, Freimachen von Stereotypen ist ein Bildungsproblem. Darin beinhaltet ist eine nicht zu unterschätzende salutogene Ressource: das geistige wie auch psychische und physische Potenzial weiter zu entwickeln. Das ist Bildung – und man braucht dazu nur Vor-Bilder – und für Bildung ist es nie zu spät.
Literatur:
Assmann Jan, Das kulturelle Gedächtnis. (1992) C. H. Beck, München 20076.
Bauer Joachim, Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und
das Geheimnis der Spiegelneurone. (2005) Hoffmann und Campe, Hamburg 20069.
Friedan Betty, Mythos Alter (1993). Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1995.
Mankowitz Ann, Auf neue Weise fruchtbar. Der seelische Prozess der Wechseljahre. Kreuz
Verlag, Zürich 1987.
Miller Alice, Am Anfang war Erziehung. (1980) Suhrkamp, Frankfurt/Main198146. – 65. Tausend.
Perner Rotraud A., Lieben! Kremayr & Scheriau, Wien 2018.
Perner Rotraud A., Prinzesschen, Kämpferin … Königin! Weibliche Kraft in allen Lebensphasen. Edition roesner, Krems 2019.
Perner Rotraud A. (Hg.); Stress & Alter. aaptos Verlag, Matzen 2006.
Trnka-Kwiecinski Aga, Inszenierungen (2006). In: R. A. Perner, Stress & Alter, S. 31 ff., s. o.
[1] Vgl. J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis.
[2] Vgl. R. A. Perner, Sein wie Gott.
[3] J. Bauer, Warum ich fühle, was du fühlst, Hoffmann und Campe 2005, S. 36 f.
[4] A. Miller, Am Anfang war Erziehung, S. 119.
[5] So habe ich während meines Studiums der Rechtswissenschaften 1962 – 1966 zwar die formalen parlamentarischen Kriterien der Gesetzwerdung zu hören bekommen, nicht aber die Möglichkeiten für die Bürgerschaft, Gesetzesvorhaben zu entrieren.
[6] In: Rotraud A. Perner (Hg.), Stress & Alter.
[7] B. Friedan, Mythos Alter, S. 129 ff.
[8] Friedan schreibt, ihr wäre aufgefallen, dass „die gerontologischen Experten das Alter mit Vorliebe in pathologische Begriffe zu fassen suchten“. A. a. O., S. 28.
[9] A.a.O., S. 769 ff.
[10] Betty Friedan stellt auch in Frage, dass der Tod die Folge von Erkrankungen sein müsse sondern zeigt auf, dass umgekehrt Krankheitssymptome den baldigen Tod anzeigen könnten: „Noch entscheidender war die Feststellung, dass Verfallserscheinungen mit der jeweiligen Nähe zum Tod zusammenhingen, nicht mit dem chronologischen Alter.“ A. a. O., S. 128.
[11] A. a. O., S. 89 ff.
[12] So hieß auch die Zeitschrift der sozialdemokratischen Frauen in Österreich in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts „Die Unzufriedene“.
[13] Unzufriedenheit kann auch als innerseelischer Hinweisimpuls verstanden werden, dass Veränderung, Weiterentwicklung oder Neugestaltung ansteht. So interpretiere ich auch den Begriff „Penisneid“ bei Freud: als gedankliches Kreisen um noch unbenannte Erfahrungen, die Entwicklung des eigenen Potenzials hemmen bzw. behindern.
[14] DER STANDARD „Agenda Frauenpower“ 1./.2 2019, Wochenendbeilage S. 6.