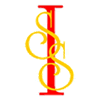Menschen, die unangenehme Erfahrungen „überlebt“, aber nicht kritisch reflektiert und „ausgedrückt“ haben, neigen dazu, diese unbewusst an andere weiterzugeben. Die häufigste solcher „unangenehmen Erfahrungen“ ist das Erleben, zu etwas gezwungen zu werden: Das beginnt schon bei den Kleinsten mit dem Zwang zu essen – dabei ist Ekel oft der erste Hinweis für eine Nahrungsunverträglichkeit, gefolgt vom Zwang zum Still-Sein oder Still-Halten, Dulden unerwünschter Berührungen, Zwang zu bestimmten Tätigkeiten aber auch zum Ertragen unerträglicher Belastungen (wie lange andauernder Lärmbeschallung – Streit der Bezugspersonen mitinbegriffen – Kälte, Dunkelheit, Angstmache, Drohungen, körperliche „Züchtigungen“, Einsperren etc. – alles, was es so an Miss-Handlungen gibt).
Der US-amerikanische Kinder- und Jugendpsychiater Bruce D. Perry beschreibt in „Der Junge, der wie ein Hund gehalten wurde“, wie traumatisierte Kinder oft ihre ganze Aufmerksamkeit der Vorsicht zum Schutz vor neuerlichen Übergriffen widmen müssen und daher nicht fähig sind, sich dem Unterricht zuzuwenden. Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich in meiner psychotherapeutischen Arbeit mitfühle, was manchen erwachsenen Menschen in ihrer Kindheit angetan wurde. Manches davon entspricht etwa dem, was im Film „Shining“ die Grenze psychischer Toleranz überschreitet (dann nämlich, wenn der mordversessene Vater, gespielt von Jack Nicholson, aus dem Blickwinkel des Kindes gezeigt/gefilmt und so die Zuseherschaft zur Identifikation mit dem lebensbedrohten Buben genötigt wird).
Daran musste ich denken, wenn am 29. Oktober in den Tageszeitungen (Kurier, „Schulschwänzen: Strafzettel wirken“ S. 3, Der Standard, „Ausbildungspflicht bringt mehr Gerechtigkeit und spart Geld“ S. 9) die Gesetzesbilanz des Jahres 2018 zu Verletzungen der Ausbildungspflicht von 15–18jährigen berichtet wurde. Da ging es vor allem darum, die Eltern in die Pflicht zu nehmen, dafür zu sorgen, dass ihr Nachwuchs fit für den Arbeitsmarkt werde und nicht der Gesellschaft zur Last falle. Ich erinnere mich aus vielen Supervisionssitzungen mit Jugendsozialarbeiter*innen wie auch aus dem Unterricht bzw. Fortbildungen in der von mir entwickelten PROvokativpädagogik, in denen das vor Inkrafttreten des Gesetzes (2017) Thema war und wir Strategien entwickelten, wie man unorthodox für Motivation der Jugendliche aber auch der Eltern sorgen könne. Wir fanden viele unterschiedliche Ursachen und Auslöser – aber von „Lust am Schulschwänzen“ war dabei nicht die Rede. (Die findet man eher in der Angeberei alter Männer, die ihre Jugend in den 1950er und 1960er Jahre rückblickend verklären. Elfriede Hammerl hat das sehr zutreffend in ihrer Seite im profil 44/2019, S. 41, kritisiert.)
Dazu ist festzuhalten: In Österreich gibt es keine „Schulpflicht“ wie in Deutschland (!) sondern eine „Unterrichts“pflicht (mit Überprüfung durch Ablegung externer Prüfungen) und die kann auf vielfältige Weise erfüllt werden – wenn man (d. h. die jeweiligen Behörden) wohlwollend ist.
Und: Schulschwänzen ist ein „übermütiges“ (da steckt das Wort „Mut“ drin) Gruppenverhalten bei Vorhandensein lustvollerer Alternativen (z. B. früher Billardspielen, heute Flippern, aber auch Vorverlegung sogenannter Freizeitvergnügen in den Vormittag …). Es ist nicht zu verwechseln mit Schulphobien und schon gar nicht mit Schulverweigerung. Letztere gibt es in passiver Form (der Körper ist im Klassenzimmer anwesend, Seele und Geist aber ganz wo anders (z.B. bei „kooperativen“ – meist unerkannt depressiven – Schüler*innen, die keine Kraft zum Widerstand mehr aufbringen, aber auch bei Ausnahmezuständen wie heftiger Verliebtheit – Sigmund Freud hat diesen Zustand den Psychosen zugerechnet!) wie auch umgekehrt in der aktiven der widerstandsfähigen (ich-starken) Schüler (meist männlich, denn bei den weiblichen findet sich dieses Verhalten eher als Begleiterscheinung von Liebesbeziehungen), die einfach „beschließen“, nicht in die Schule zu gehen, und gerade die sind die durch ihren vorhandenen „Antrieb“ selbstmordgefährdeten, wenn sie von inkompetenten „Experten“ zum Schulbesuch gezwungen werden.
Als ich in den 1970/80er Jahren als Führungskraft in den Jugendzentren der Stadt Wien arbeitete, absolvierte ich damals eine spezifische dreijährige Ausbildung zu u. a. Konfliktbewältigung zwischen Lehrerschaft, Elternschaft und schulverweigernden Kindern und Jugendlichen (bzw. anderen Problemen wie etwa im Sucht- oder Kriminalbereich). Wesentlich war dabei, Druck, Drohungen und Zwang zu vermeiden und stattdessen alternatives – personzentriertes – Verhalten einzuüben. Meinen Supervisand*innen wie auch Student*innen konnte ich das vermitteln. Bei anderen für die Wahrung des Kindeswohls Beauftragten vermisse ich leider oft diese Bereitschaft zum Gewaltverzicht. Sie merken nicht, dass sie damit bereits vorhandene Vorbehalte zu Recht verstärken.