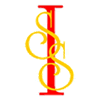„Was ein Mensch sieht, hängt sowohl davon ab, worauf er blickt, wie davon, worauf zu sehen ihn seine visuell-begriffliche Erfahrung gelehrt hat.“, schreibt Thomas S. Kuhn in seinem Grundsatzwerk „Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen.“ (S. 125) Dieser Satz stimmt auch, wenn man „sehen“ durch „hören“ ersetzt oder eine andere Sinneswahrnehmung, denn es wird uns von klein auf durch „Autoritäten“ beigebracht, wie etwas zu verstehen sei – oder später, im Fremdsprachenunterricht, wie man etwas „übersetzen“ soll – und viele protestieren dann sofort, wenn sie mit einer neuen Sichtweise oder Interpretation konfrontiert sind, anstatt nachzudenken, wie diese zustande kam.
Mir ging es so, als ich am 26. Jänner den Titel des Kurier-Interviews mit Susanne Raab, studierte sowohl Juristin wie auch Psychologin, und neuerdings zusätzlich zur Frauen- und Integrationszuständigkeit auch Familienministerin, „Familie ist dort, wo Kinder sind“ erblickte – ein Zitat aus deren Antworten.
Diese Interpretation folgt wohl dem Vorbild der „heiligen Familie“ Josef, Maria und Jesuskind, vermutete ich. Meine hingegen fokussiert auf das enge Zusammenleben mit Verantwortlichkeit für schwächere, egal ob jünger oder älter, ärmer oder wohlhabender, kränker oder gesünder etc., und ich beziehe nicht nur die „family of blood“ in meine Interpretation ein, sondern auch eine mögliche „family of choice“.
Letztere, auf freier Wahl beruhende, bedeutet einen Paradigmenwechsel: Sie lässt andere Gestaltungen zu – so wie etwa die früheren Großfamilien oder Familienverbände oder Adoptivfamilien oder, wie in anderen Kulturen, Mehrfrauen- oder Mehrmännerfamilien. Ja, sogar solche existieren – im Südwesten Chinas nahe Tibet, nachzulesen in „Das Land der Töchter“ von Yang Erche Namu.
Im Jusstudium lernt man im Römischen Recht, dass „familia“ (Familie – Wikipedia ) alles umfasste, was dem pater familias – dem männlichen Machthaber – „gehörte“, Hab und Gut und dabei auch die Sklavenschaft inbegriffen. Neugeborene wurden ihm zu Füßen gelegt, und erst wenn er sie aufhob, wurden sie zu einem Teil seiner Familie. (Andererfalls mussten sie „entsorgt“ werden, egal wie.) Auch hier erkennen wir ein anderes Paradigma als das heute gewohnte – und ebenso den Kern des jeweils aktuellen juristischen Denkens, dass es nämlich von vorherrschenden Machtinteressen abhängt, was jeweils in Gesetzesform festgelegt wird – denken wir nur an den damals eklatanten Paradigmenwechsel zum Erbrecht auch außerehelicher Kinder (1991).
Die Pandemie 2020 und Folgejahr/e wird wohl auch etliche Paradigmenwechsel erfordern, vor allem als Abkehr von gewohnten Arbeits- und Unterrichtsformen bis zu Wohnungsgestaltungen. In meinem Familienbetrieb haben wir immer schon solche flexiblen Alternativen miteingeplant – aber als Unternehmensberater kennen wir auch die Widerstände, die auftauchen, wenn etwas in Bewegung kommt. Insofern wünsche ich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner Erfolg, wenn sie – wieder ein Interviewtitel im Kurier (27.01., S. 6) – betont, sie sei „nicht hier, damit alles so bleibt, wie es ist“. Vielleicht greift sie den Paradigmenwechsel auf, den ich – ehemals Dozentin an der Militärakademie – dafür in einem Konzept schon 2013 erstellt habe, und der gleichzeitig mehrere andere Arbeitsprobleme lösen könnte.