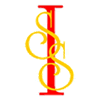Seit den mal mehr, mal weniger zielführenden Anti-Corona-Maßnahmen stehen sich teilweise erbitterte Gegner und Gegnerinnen gegenüber. Warum sich jemand für oder gegen eine Impfung entscheidet, interessiert sie nicht – das wäre ja sonst ein Beziehungsangebot – sondern allein die Tatsache, dass keine Gefolgschaft geleistet wird, reicht, um in hocherregte Kampfstimmung zu geraten. Erinnerungen an Religionskriege werden wach – aber auch an rassistische Ideologien: Gegner müssen vernichtet werden. (Politische Verfolgungen lasse ich jetzt aus, weil es die immer gegeben hat, primär wie auch immer sekundär, wenn es leicht ging, unliebsame Konkurrenz oder Kritik zu vernichten, indem man nahestehende ideologische Lager verstärkte … geschieht ja auch in Familien und Betrieben!)
Seit etwa zwanzig Jahren ist dabei ein neues altes Phänomen zu beobachten: Neu, weil es sich in der breiten Öffentlichkeit elektronischer Medien abspielt und nicht mehr in elitären Zirkeln, egal ob in Parteikellern oder Universitätshörsälen. Alt, weil es seit der historischen Aufarbeitung des Aufbaus und der Propaganda von National- wie ebenso Sowjetsozialismus eigentlich allseits bekannt und erkennbar sein sollte: Es wird Gerechtigkeit versprochen – aber nur für sich selbst und die eigenen Parteigänger. Wer nicht dazugehört, muss vernichtet werden, und das beginnt damit, dass der Person Zeit und Raum, vor allem aber Respekt genommen wird: „Noch vor dem Einfluss des Postmodernismus lag der Schwerpunkt der Identitätsforschung bereits auf der Frage nach der Beziehung zwischen der eigenen Identität und der eigenen Befähigung, etwas zu wissen.“, schreiben Helen Pluckrose und James Lindsay in ihrem Buch „Zynische Theorien“ (S. 218), Weniger hochgestochen formuliert, bedeutet dies: Welche Beziehung zur eigenen Erkenntnis gesellschaftlicher Machtverhältnisse hat jemand, der / die selbst von Macht oder Machtlosigkeit betroffen ist – oder noch einfacher gesagt – muss man aus eigenem Nachteil oder Privileg nicht von vornherein Vorurteile haben? Oder sieht man die nur beim anderen, nicht bei sich selbst? (Vgl. Bergpredigt Mt 7, 4 mit dem Gleichnis vom Splitter im Auge des Nächsten und Balken im eigenen.)
Bliebe es aber nur bei der Bearbeitung der Fragestellung! Aber weit gefehlt, definieren sich diejenigen, die sich aktuell oder als Nachkommen ihrer Ahnen benachteiligt fühlen, als Opfer und leiten davon das Recht ab, gegen diejenigen, die sie privilegiert wähnen (das Wort leitet sich von „Wahn“ ab), einen Ausschluss- und Verbots-Krieg zu führen: Redeverbote, Berufsverbote … wurde alles in der NS-Zeit schon vorgelebt, war aber nur der Beginn des Vernichtungsfeldzugs.
Auch wenn sich jemand „diskriminiert“ oder gar „traumatisiert“ fühlt, wenn er oder sie angefeindet wird, ist das noch kein Nachweis von Realität.
Realität muss – zumindest nach den noch immer geltenden Regeln demokratischer Staaten – objektiv nachweisbar sein. Dafür gibt es Antidiskriminierungsgesetze oder Verfassungen so wie in der österreichischen, Artikel 7: (1) Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. (Dazu noch eine Anmerkung von mir: Ich habe mich – nicht nur als Vorsitzende der Österreichischen Gesellschaft für Sexualforschung 1996–2002 – jahrelang dafür eingesetzt, dass in Art. 7 BVG auch noch „sexuelle Orientierung“ oder „Identität“ ergänzt werden soll – auch wenn sich hier irgendwann einmal etwas ändern könnte – es geht ja um juristische einklagbare Rechte, wenn nachweislich diskriminiert, d. h. benachteiligt wurde.)
Traumata hingegen werden nach genauen Symptomen diagnostiziert; fehlen diese, kommt eine andere Diagnose zum Tragen – oder eben keine. Viele Menschen übernehmen ja unbewusst von ihren Bezugspersonen der frühen Kindheit Reaktionsmuster von Beleidigt-sein oder Strafschweigen – und manche setzen dies bewusst ein, um Schuldgefühle zu erzeugen (und sich Aufmerksamkeit und Zuwendung zu akquirieren).
Die Seele ist eben ein weites Land (leicht abgewandeltes Zitat nach Arthur Schnitzler).