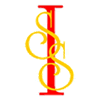Dass ich die Neuwortschöpfung „Femizid“ ablehne, dürfte der Leserschaft meiner „Briefe gegen Gewalt“ bekannt sein: Denn während das sprachliche Vorbild „Genozid“ beinhaltet, dass alle Angehörigen einer Volkseinheit gezielt ermordet werden, treffen diese beiden Generalisierungen auf diese Frauenmorde nicht zu.
Ich verstehe und unterstütze schon auch, dass mit diesem Neologismus versucht wird, von der medial wie polizeilich üblichen Formulierung „Beziehungstat“ wegzukommen – obwohl sie durchaus zutrifft: Es handelt sich ja immer, wenn auch oft gut getarnt, um eine Gewaltbeziehung. Dass diese schwer zu bearbeiten sind, hat Robin Norwood in ihrem Langzeit-Bestseller „Wenn Frauen zu sehr lieben“ ausführlich aufgezeigt; allerdings hat sie den Angst-Aspekt zu wenig bearbeitet – nicht nur den der Frauen, sondern auch den der Anverwandten wie auch Nachbarn, die sich erst dann zur Einmischung aufrappeln, wenn es meist zu spät ist.
Ich bevorzuge meine Wortschöpfung „Strafmord“ – denn das Ziel ist aus meiner fünf Jahrzehnte langen juristischen wie auch sozialtherapeutischen und psychotherapeutischen Erfahrung, die „Unbotmäßigkeit“ – also den Widerstand gegenüber der Erwartung, die Partnerin müsste sich wie ein Dienstbote unterwerfen – zu bestrafen. Dass dahinter die Selbstberechtigung zum Richter- und Strafamt steht, gehört zu den „Glaubenssätzen“ einer hegemonial gedachten Männlichkeit – einer Männlichkeit, die wähnt, sich nur mit Gewalt durchsetzen zu können und die damit ihre Unsicherheit und Ohnmacht kompensieren will. Dazu werden viele noch immer erzogen – durch das Männervorbild in der Familie, religiöse Indoktrinierung, wie auch filmische Verhaltens-Modelle.
Deswegen fordere ich nunmehr schon seit dreißig Jahren staatsfinanzierte (!) Spots als Unterbrecher- oder Abschlusswerbung bei gewaltträchtigen Filmen, in denen die strafgesetzlichen Folgen wie auch Verhaltensalternativen in (den von mir erfundenen und universitär gelehrten) PROvokativpädagogischen Methoden aufgezeigt werden. Die dazu begründenden Formen habe ich bereits in den 1990er Jahren – damals im Gespräch mit Walter Schiejok – erarbeitet. Leider ist er mir während dieser Zeit, in der ich viel für den ORF gearbeitet habe, abrupt durch die hausinternen Umgestaltungen „abhanden gekommen“ – ebenso wie Ernst Wolfram Marboe.
Auch wenn die derzeitige Frauenministerin (ebenso wie ich, ich allerdings dazu noch ausgebildete Mediatorin, Pädagogin, Sozialtherapeutin und Theologin mit jahrelangen politischen Funktionstätigkeiten) sowohl Juristin wie auch Psychologin ist, beruht ihre Berufserfahrung aus dem universitären und ministeriellen, daher theoretischen Bereich. Man muss aber jahrelang im Konfliktfeld mit allen beteiligten Konfliktparteien (also allen im „System“ aufeinander einwirkenden Personen) praktisch und „allparteilich“ (also nicht nur parteilich für Frauen) gearbeitet haben, um die Beweggründe aller zu erfahren, und man muss über die Methoden der psychoanalytischen Sozialtherapie verfügen, wenn man Veränderung bewirken will.
In meiner Vorlesung „Angewandte Sozialpsychologie für JuristInnen“ am Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien habe ich 2016–2018 den künftigen KollegInnen die wesentlichen Bausteine dieser Arbeit vermittelt. Mein Angebot steht noch immer. Möglicherweise nimmt es die derzeitige Justizministerin wieder auf …