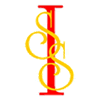Dass Krankenpflegepersonen keine Auskünfte erteilen dürfen, die unter ärztliche Expertise fallen, zählt zu der „divide et impera“ (lateinisch „teile-und-herrsche“) Strategie beruflicher Konkurrenten. Aber jeder Profession ein eigenes Wirkungsfeld zu bieten, heißt noch lange nicht, dass deren besondere Qualifikationen als gleichwertig gewürdigt werden; es liegt dann an der jeweiligen Persönlichkeit, ob „kollegiale Führung“ (wie im Spitalswesen) funktioniert oder durch hierarchische Machtspiele gefährdet wird.
So erinnere ich mich an einen Konflikt in einer derartigen Institution, in der der Pflegedirektor eine Pflege-Visite ergänzend zur ärztlichen einführen wollte und beim Ärztlichen Direktor auf blanke Ablehnung stieß – es hätten nämlich die Ärzt:innen mitgehen sollen (eine klare Abwertung der „anderen“ Sichtweisen der Pflegewissenschaft). Ähnliche Diskrepanzen gibt es oft auch dort, wo Jurist:innen die Sichtweisen der heute ebenso im Magisterium ausgebildeten Sozialarbeiter:innen bloß als untergeordnete Ergänzung ansehen statt als primäre Sicht auf menschliches Leben und Erleben.
Vor kurzem berichtete mir ein Arzt, ihm sei in dem Wiener Spital, in dem er sich über Zuweisung einer speziellen Untersuchung unterzogen hatte, die Besprechung seines eigenen Befundes verweigert worden – weil die Ärztin, die die Untersuchung geleitet hatte, nicht im Hause anwesend war, und der angeforderte Vertreter sich als unzuständig erklärte. Außerdem wurde auch darauf hingewiesen, dass der zuweisende Arzt ein extra Ansuchen stellen müsse, um die Bilddokumente zu erhalten. (Ich meine mich zu erinnern, dass mit solchen Regelungen Mehrfachanforderungen verschiedener Ärzte verhindert werden sollten – ich muss das noch nachprüfen.)
Ich frage mich nun: Wem gehört ein Befund bzw. die dazu gehörigen Bilder? Den Patient:innen? Dem Spital? Dem Sozialversicherungsträger?
Und ich gebe die Antwort: Doch klarerweise den jeweiligen Patient:innen, die ja mit ihren Sozialversicherungsbeiträgen die beiden anderen Einrichtungen (mit)finanzieren.
Was in dem zitierten Fallbeispiel aber zutage tritt, ist die Missachtung der mündigen Patient:innen (oder auch Klient:innen, wenn es sich um einen anderen Bildungs-, Gesundheits- oder Sozialberuf handelt), die ihr Recht auf Information über ihre Befindlichkeit einfordern.
Nun wird üblicherweise sofort protestiert und Missachtung abgestritten – eine Form verweigerter Selbstkontrolle: Es liegt nämlich oft an fehlender Sprachschulung, „auf Augenhöhe“ kommunizieren zu können. Das würde nämlich erfordern, Fachwissen nicht als „Eigentum“ – juristisch: das Recht, mit einer Sache nach eigenem Willen walten und schalten zu dürfen – anzusehen, sondern als Verpflichtung, es mit anderen zu teilen, und zwar in einer Form, die weder ängstigt noch demütigt. Beides bedeutet Gesundheitsschädigung – und besonders Angehörige von Bildungs-, Gesundheits- und Sozialberufen haben als wesentlichste Grundaufgabe, anderen Menschen mehr Wissen und Kompetenz, weniger Stress und mehr Heilung, weniger Diskriminierung und mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu vermitteln.