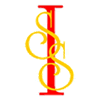In meiner Facebook-Blase taucht immer wieder ein Foto und Spruch der oberösterreichischen Gerichtspsychiaterin und Autorin des giftgrünen Büchleins „Dummheit“ (Verlag Kremayr & Scheriau, 2021) Heidi Kastner auf, der sinngemäß lautet, heute würden sich dumme Leute ihrer Dummheit nicht mehr schämen.
Wie könnten sie auch – wenn sie ihre von Kastner diagnostizierte Dummheit gar nicht wahrnehmen … denn würden sie das, wären sie ja nicht mehr dumm.
In ihrer Tätigkeit als Gerichtssachverständige wäre sie immer wieder mit leicht intelligenzgeminderten Menschen konfrontiert gewesen, schreibt Kastner – aber es sei meist Gier, Wichtigtuerei oder die Unwilligkeit, Grenzen zu akzeptieren, die sie vor Gericht gebracht hätten, und so teilt sie diese Personen auch in „Lernverweigerer“ und „Denkfaule“ ein, erweitert mit „Querulanten“, „Faktenverweigerern“, „Ignoranten“, „Verschwörungstheoretikern“, und widmet sich schließlich denen, denen aus ihrer Sicht „emotionale Empathie“ fehlt. Aber gibt es denn auch eine andere als emotionale? Aus psychotherapeutischer Sicht bedeutet Empathie 100%ige Einfühlung – also viel mehr als nur Mitgefühl; sich in jemand anderen „hineindenken“ oder ihn bzw. sie verstehen zu können, ist daher keine Empathie (weil dies heute ja ein Modewort geworden ist). Darüber bei Carl R. Rogers (1902–1987), der als erster Empathie als Heilfaktor erkannt hat (und den ich noch als Ausbildner erleben durfte), nachzulesen, ersetzt nicht die Bereitschaft und Erfahrung, sich von Gefühlen anderer zutiefst betreffen zu lassen – besonders, wenn man an die Grenze der Unerträglichkeit kommt (wie z. B. der Machtlust von Sexualstraftätern). Deswegen hat Rogers auch immer davor gewarnt, zu werten bzw. zu bewerten – und deswegen habe ich publizistisch davor gewarnt, als Psychotherapeuten zu „begutachten“ (weil unsere Beziehungsformen wie auch Sprache vermutlich therapeutisch wirkt und daher die Gesprächspartner:innen verändert – und das ist nicht der Sinn einer Begutachtung „im Nachhinein“).
Was mir bei dieser Beurteilungs-Palette abgegangen ist, ist der kommunikative Aspekt: Dass nämlich als „dumm“ be- und verurteilt wird, was man selbst nicht versteht oder akzeptiert bzw. sich damit nicht „empathisch“, d. h. einfühlsam und wertschätzend auseinandersetzen will.
So schreibt der ungarisch-französische Ethnologe und Psychoanalytiker (und Ausbildner von Psychiatern) Georges Devereux (1908–1985): „Das Selbst-Modell beeinflusst die psychiatrische Diagnose auf zweierlei Weise: 1. Kandidaten der Psychiatrie – und manchmal sogar qualifizierte Psychiater – neigen, ehe sie Kurse in Ethnopsychiatrie absolviert haben, dazu, jeder Abweichung von den Standards ihrer eigenen Gruppe als symptomatisch für psychische Krankheiten zu nehmen; übliche indianische Verhaltensmuster können folglich als Symptome gewertet werden. Die Bedeutung eines eher indianischen Selbst-Modells für die Diagnose und die Formulierung therapeutischer Ziele wird durch das bittere Scherzwort beleuchtet, dass jedes psychiatrische Lehrbuch den Titel tragen sollte: ,Wie du mehr so wie ich werden kannst.‘ 2. Nach ethnopsychiatrischen Kursen werden Kandidaten der Psychiatrie manchmal spitzfindig und definieren selbst manifeste Symptome für Nervenkrankheiten als normales Indianerverhalten.“ („Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften“, Suhrkamp TB, S. 207 f.)
In Walter Wippersbergs Parodiefilm „Das Fest des Huhnes“ aus 1992 (Das Fest des Huhnes – Wikipedia) erforschen und dokumentieren afrikanische Wissenschaftler das Kultverhalten der „oberösterreichischen Ureinwohner“ auf Art der europäischen Forschungsmethoden in Afrika: So wundern sie sich etwa kommentierend über ein traditionelles Fest im Oktober, bei dem literweise Bier getrunken, Hühner verspeist und seltsame Tänze vollführt werden. Das erinnert mich auch an ein Kinderbuch, in dem die Fische im Aquarium „ihre“ Familie beobachten und kommentieren … wie auch irgendein, vermutlich chinesischer, Weiser festgestellt hat: „Für den Fluss sind es die Brücken, die fließen.“