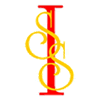Vor dreißig Jahren hätte ich vielleicht gedacht, dass es fortschrittlich und human wäre, Schwerkranken zu helfen, ihr – vermutlich unerträgliches – Leben so beenden zu lassen, wie sie es wollen: Ein Glaserl, ein Gifterl, ein Schlaferl (absichtlich verkleinert um der Verantwortung die Last zu nehmen) und alles ist vorbei.
Dann hatte ich ab den 1990er Jahren viele Kontakte mit hohen Tetraplegikern, mit Vollbild-Aids-Erkrankten, mit Krebspatienten im Endstadium und erkannte urplötzlich, auf welche Weise es gelingen kann, Schmerzen seelisch und geistig so zu transformieren, dass der Augenblick, in dem man noch lebt, Gewinn ermöglicht. Es hängt mit dem Atmen zusammen. Man muss es verlangsamen, dehnen – und man muss seine Gedanken kontrollieren.
Vor zwanzig Jahren habe ich dann in der Akademie für Ganzheitsmedizin, in der ich selbst als Dozentin unterrichtete, Pranaheilen gelernt und eine zusätzliche Technik kennen gelernt und mit meinem psychotherapeutischen Wissen erweitert, und diese meine Methode brauchte ich dann vor zehn Jahren, als ich einen schweren Autounfall hatte, nicht aus meinem am Dach liegenden Auto aussteigen konnte (die Türen waren blockiert) und die Rauchentwicklung der aufgegangenen Airbags als Brennen interpretiert (zu der Zeit, als ich meinen Führerschein machte, gab es noch keine Airbags, daher auch keine Informationen dazu). Ich habe mich also autosuggestiv aufs Sterben vorbereitet – und das war auch einer der Gründe, weshalb ich ein Semester später begann, Theologie zu studieren. Evangelische. Ich wollte verstehen, was ich auf dem Feld kurz nach Bockfließ erlebt hatte. (Ich habe das in meinem Buch „Als Pfarrerlehrling in Mistelbach“ beschrieben.) Im Theologiestudium haben wir dann erfahren, dass sich die Menschen im Mittelalter mit der „ars moriendi“ – der Kunst des Sterbens – vertraut machten, um – in heutiger Sprachform – „kompetenter“ zu sein, wenn es auf die letzte Reise ging. Ob der Reiseführer dann auch wirklich dazu verholfen hat, weiß ich nicht, zumindest sind mir keine „Reiseberichte“ bekannt.
Heute wird diese Anleitung außen gesucht – und in der Schnelle, anstatt innen und in Langsamkeit.
Eine Ursache dafür sehe ich in dem zunehmenden Tempo, aber auch in der Überforderung derjenigen, die begleitend „bei-stehen“ könnten und auch sollten, nur sagt ihnen niemand, wie man das tut … Dafür vermittelt man ihnen aber ein schlechtes Gewissen, wenn sie es tun wollen und dafür Urlaubstage beanspruchen möchten, und so gehen Gewissen und Liebe zum Nächsten verloren bzw. werden ans Hospiz wegdelegiert.
Was ich aus vielen Gesprächen mit Todkranken, mit Hinterbliebenen, vor allem auch denen von Selbsttötern, mitgenommen habe: Sie brauchen und wünschen liebevolle Begleitung – und weil sie die nicht erhoffen, erwarten, erbitten, wollen sie diese Sehnsucht nicht mehr spüren, und das möglichst schnell. Ich gebe zu: Auch ich würde gerne in den bergenden Armen des Mannes, den ich liebe, mein Leben ausatmen – und weiß, dass er die dazu nötige Liebe nicht aufbringen wird, weil er mit dem Ertragen von Liebe ein Problem hat (wie viele Männer, die in Verliebtheit oder Begehren hängen bleiben, weil sie geschenkte Liebe nicht tief genug „einatmen“ können), obwohl er in einem Beruf arbeitet, in dem viel von Liebe geredet wird.
Ich finde es problematisch, die Entscheidung über die Zulässigkeit von Sterbehilfe Juristen zu überlassen, denn dieser Beruf (ich hab ihn ja auch selbst als Erstberuf erlernt) zeichnet sich nicht durch Sensibilität und Empathie seiner Angehörigen aus, und diese fehlt auch vielen Angehörigen anderer psychosozialer Berufe, denn dazu braucht man Zeit, die man ihnen nicht zugesteht (siehe 35 Stunden sind genug!). Aber das Herz liebend zu weiten und Angst und Leid, Leiden (und dessen Abwehr in Resistenz, Ärger oder Bosheit) mitfühlend auszuhalten, braucht Zeit – viel Zeit.