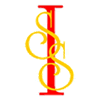In Ergänzung zu meinem „Brief gegen Gewalt“ Nr. 37 möchte ich gerne einfach und deutlich präzisieren, was Trauma bedeutet, woran man es erkennt und wie man es in die eigene Biographie integrieren kann.
Ein psychisches Trauma ist ein lebensgeschichtliches Ereignis, das die zur Bewältigung verfügbaren Ressourcen übersteigt, d. h. man weiß bzw. kann es nicht bewältigen. (Unter einem physischen Trauma versteht man üblicherweise jede gröbere Körperverletzung – um dazu die Diagnose psychisches Trauma zu konstatieren, müssen bei einem durchschnittlich kundigen Erwachsenen weitere Bedrohungen für Leib und Leben dazu kommen; bei Kindern, die noch unkundig sind, oder Menschen, die spezifisch körperbehindert sind, reichen da schon Überraschungen wie ein sich schnell annähernder große Hund – denn bedingt durch deren Minder-Größe ist das, was für einen Durchschnitts-Erwachsenen nicht einmal ein Mikrotrauma darstellt, oft ein Makrotrauma.)
Die Begleiterscheinungen des sogenannten Posttraumatischen Belastungssyndroms (es gibt auch ein Verbitterungssyndrom) sind üblicherweise Intrusionen (wiederkehrende Erinnerungen, Zwangsgedanken oder -bilder, -töne, -gefühle etc.), Angstanfälle, Vermeidungsverhalten, Schlafstörungen oder manchmal auch Essstörungen, Entwicklung von Ticks oder auch Symptomen, die quasi eine körpersprachliche Botschaft vermitteln … und meist mehreres zusammen. Es braucht oft hohe Empathie und bestimmte psychotherapeutische Methoden, um die vorgebrachten Beschwerden einem – meist (noch) nicht bewussten – Trauma zuordnen zu können, aber: Trauer nach einem Todesfall oder anderem Verlust ist noch kein Trauma – daher ist es unseriös (auch von sogenannten Fachleuten), gleich mit dieser Diagnose aufzuwarten – sie fördert nur narzisstische Besonderheitsansprüche, und diese merkt man daran, in welcher Weise davon berichtet wird.
Bei einem echten Trauma wird die belastete Person vermeiden, sich an die Auslösebegebenheit zu erinnern: Sie retraumatisiert nämlich, d. h. es werden die Gefühle der Ursprungsszene neu hervorgerufen. Das passiert häufig bei Befragungen durch Polizei, bei Gericht und leider oft auch durch Ärzte oder andere Gesundheits- oder beratende Berufe, und leider vor allem auch durch Angehörige, die unaufhörlich trösten wollen.
Zur Traumabewältigung gibt es viele erprobte psychotherapeutische oder psychotherapienahe Methoden, aber oft „macht der Körper die Arbeit“ – beispielsweise durch anscheinend unbeherrschbares langandauerndes Zittern, Stöhnen, Gähnen (!) oder einfach nur Ausatmen. Diese Selbstheilungsprozesse sollten nie unterbrochen werden, sehr wohl aber fürsorglich begleitet. Dazu gehört auch das aufmerksame Zuhören, wenn jemand immer und immer wieder erzählen will, was ihr oder ihm passiert ist. Debriefing heißt das: Aus der Fixierung im Gefühl von Angst und Entsetzen in einen Rückblick auf etwas zu gelangen, das man überlebt hat.