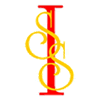Der wohl wichtigste Grundsatz in den meisten Psychotherapieschulen lautet „bedingungslose Akzeptanz“ und bedeutet, dass die „Seelenbegleiter“ bewusst – und hoffentlich irgendwann „automatisch“ – auf die alltagsübliche Reaktion verzichten, andere zu bewerten.
Den meisten Menschen ist dies ja nicht bewusst, so sehr sind sie aus ihrer Kindheit gewohnt, mit Absolut-Setzungen wie „Du bist schlimm!“ oder „faul“, „stur“ bzw. „lieb“, „fleißig“ oder „brav“ innerhalb einer Bandbreite von unerwünschtem und erwünschten Verhalten „etikettiert“ zu werden. Dabei wird der Unterschied zwischen dem „gewordenen“ Sein einer Person und ihrem aktuellen „gewählten“ Verhalten verwischt.
Eine Person ist aber viel mehr als ihr augenblickliches Verhalten, denn dieses könnte sie ja auch ändern – wenn man sie darum bittet (und ihr auch gute Gründe dazu anbietet) – und wenn sie auch „weiß“, wie man das macht. Das lernt man üblicherweise dann an seinen Vorbildern, wenn die nicht nur „tun“ sondern auch ihren Denkvorgang erklären. Das nennen wir dann Anleitung. Leider wählen die meisten – privaten wie professionellen – Erziehungspersonen die Befehlsform ohne Anleitung zu geben oder gar Strafen „im Nachhinein“ für unerwünschte Folgen, ohne zu erklären, wo auf der Zeitlinie anderes Handeln sinnvoll (oder auch nur von ihnen erwünscht) gewesen wäre. Dazu müsste man nämlich vom „hohen Richtertisch“ (einer Einschüchterungsinszenierung, die es in der österreichischen Realität heute ja nicht mehr gibt) herabsteigen und mehr von sich selbst herzeigen … Tatsächlich geschieht das ja auch, denn „immer wenn man etwas von sich gibt, gibt man etwas von SICH“. In der Psychoanalyse zählt dies zum Sammelbegriff Projektion: Man unterstellt anderen etwas ohne nachfragende Überprüfung und „beweist“ damit tatsächlich die eigenen Phantasien.
Als ich im Februar 2019 mich auf Facebook anmelden ließ (bin altersbedingt in solchen Handlungen ungeübt), hatte ich nur ein einziges brauchbares Foto von mir – vom Juli 2009, und dachte, außer ein paar Falten am Hals sehe ich ohnedies noch ziemlich gleich aus, nur meine Frisur ändert sich (leider) von Tag zu Tag, wie es halt bei Leuten mit Naturlocken so ist. Das Bild habe ich vor wenigen Tagen austauschen lassen (ich habe diesen Vorgang noch immer nicht gelernt), weil mein jüngerer Sohn (Kamera-Assistent) heuer Ende März endlich mal Zeit hatte, mich zu fotografieren. Und prompt „etikettiert“ mich eine persönlich unbekannte Frau, ich sähe „traurig“ aus – eine Projektion. Ähnlich hat mir ein Mann das Etikett umgehängt, mein Predigttext für meine neuerliche Amtseinführung „triefe“ vor „Überheblichkeit“ – und auch damit mehr von seiner Resonanz preisgegeben. Dabei meine ich, meine Bereitschaft zum Dialog beweist das Gegenteil – ich hätte ja seine „Annäherungen“ bzw. Grenzüberschreitungen mit einer naheliegenden Diagnose ignorieren können …
Nun hat das Wort „traurig“ ja Doppelbedeutung: Einerseits beschreibt es eine Stimmungslage (und die trifft auf mich nicht zu – traurig war ich das letzte Mal heuer im Jänner als Adolf Holl starb), andererseits ist es eine Bewertung und „umrahmt“ Misserfolge, beispielsweise hinsichtlich der Leistung von Künstlern.
Ich sammle solche sprachlichen Negativ-Beispiele und nütze sie, wenn ich für „Helfende Berufe“ ausbilde. Sie schaden und setzen Schadensketten in Gang. Die „helfenden“ Alternativen sind Nachfragen und – die eigenen Resonanzen kontrollieren.