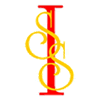Rotraud A. Perner
Wenn eine Gesellschaft etwas als ,natürlich‘ erklärt,
will sie damit nur ausdrücken,
dass sie etwas als unangreifbar wünscht.
Volker Elis Pilgrim
(Zitate wurden der neuen Rechtschreibung angepasst.)
Um etwas wahrzunehmen, braucht man ein spezifisches Wahrnehmungsneuron. Um es zu erinnern und zu kommunizieren, braucht man dafür eine sprachliche Repräsentanz. Fehlt dieses „Handlungsneuron“, bleibt es bei einer körperlichen Empfindung, und wenn diese zu Ausdruck und Veränderung drängt, ein mehr oder weniger emotional ausgelöster Impuls, möglicherweise auch nur eine bildhafte Phantasie. Oft führt solch ein Fragment eines möglichen Verhaltensreichtums zu physischen Gewaltaktionen. Durch Sprache ausgedrückt, könnte aber auch ein gewaltverzichtender Verhandlungsprozess eingeleitet werden, der in Einigung endet – oder im Gegenteil in einer Manipulation, in der die behauptete Entscheidungs“gewalt“ als unvermeidbar (z. B. als „natürlich“) versteinert wird.
Letzteres soll Thema dieser meiner Überlegungen sein.
In den Jahren, in denen ich als Professorin für Gesundheitskommunikation und Kommunalprävention und stellvertretende Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen (für die ProfessorInnenkurie) an der Donau Universität Krems angestellt war, war ich 40 % dem Zentrum für Chinesische Medizin und Komplementärmedizin, 40 % dem Zentrum für Management und Qualitätssicherung im Gesundheitswesen und 20 % dem Bereich Frauenförderung und Genderkompetenzen zugeteilt. In letzterem Bereich führte ich kontinuierlich zahlreiche Coachinggespräche mit Kolleginnen in unterschiedlichsten Aufgabenbereichen durch. Ergänzt durch Erfahrungen aus meiner freiberuflichen Praxis als Psychotherapeutin, Gesundheitspsychologin und Juristin brauchte es einige Zeit, bis mir die wiederkehrenden top-down-Muster von Behinderung wie auch Ausbeutung in ihrer stillschweigenden Hinnahme als scheinbar normales „Führungsverhalten“, tatsächlich jedoch traditionelle Form struktureller Gewalt klar wurden.
Was bedeutet „strukturelle Gewalt“?
Nach dem norwegischen Soziologen, Friedensforscher und Träger des Alternativen Nobelpreis Johan Galtung (* 1930) liegt strukturelle Gewalt dann vor, „wenn Menschen so beeinflusst werden, dass ihre aktuelle somatische und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potenzielle Verwirklichung“.
Gewalt wird hier definiert als Ursache für die Differenz zwischen dem Potenziellen und dem Aktuellen, also dem, was hätte sein können und dem, was ist, wobei damit nicht nur die ungleiche Ressourcenverteilung angesprochen ist sondern vor allem die ungleiche Entscheidungsgewalt hinsichtlich der Ressourcen. Galtung nimmt an, dass personelle wie strukturelle Gewalt symmetrisch sind, d. h. keiner der beiden wird zeitlich, logisch oder wertmäßig der Vorrang gegeben. (Posern: 37) Der Gewaltbegriff ist damit nicht mehr epistemisch an ein handelndes Subjekt (oder auch kollektive Täterschaft) gebunden sondern wird von den Folgen her beurteilt.
Gewalt kann aber auch von den Zielen her beurteilt werden. So dient Gewalt – beispielsweise verkörpert durch einen frauenfeindlichen Männlichkeitsstil – u. a. auch der Identitätsbildung. (Dinges: 177) Dementsprechend kann man schließen, dass auch Entscheidungsgewalt bzw. der Ausschluss davon und die dabei praktizierten Entscheidungsstile identitätsbildenden Charakter besitzen – zum Beispiel für eine Identität als Führungskraft, als WissenschaftlerIn, als Hilfskraft und so weiter. Die Geschichte zeige, wie Gewalt aus religiösen (Priester-) und öffentlichen (Richter-)Rollen abgeleitet und legitimiert wurde; auch autobiographische Zeugnisse legten dar, dass die Gewalttätigen ihre Gewaltausübung als heilsame „Pädagogik des Horrors“ zur Abschreckung gegen Konterrevolutionäre für legitim hielten. (Dinges: 179)
Wer richterliche Aufgaben – beispielsweise die Beurteilung von Verhalten – Leistungen und Gesinnungen inklusive – übernommen hat, läuft Gefahr, bewusst oder unbewusst konträre Sichtweisen als Infragestellung oder Verletzung dieser Bewertungsmacht zu deuten.
Die Aufgabe des Wissenschaftsbetriebs
Nach dem Universitätsgesetz 2002 in geltender Fassung, 1. Teil, 1. Abschnitt, 1. Unterabschnitt (Grundsätze, Aufgabe, Geltungsbereich) § 3. Ziffer 4 zählt zu den Aufgaben der Universitäten ausdrücklich auch die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchs (zusätzlich zu Forschung und Lehre s. Ziffer 1).
Während jedes Vereinsstatut ausweisen muss, mit welchen Mitteln die Ziele des Vereins erreicht werden sollen, steht nichts im Universitätsgesetz, wie konkret diese Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchs‘ bewerkstelligt werden soll.
Als Richtlinie bietet sich dafür der Begriff der Gesundheitsförderung an, der die Befähigung des Menschen zur möglichst weitgehenden Kontrolle der Bedingungen ihrer Gesundheit zum Inhalt hat. Gesundheit wird dabei entsprechend der Definition der Weltgesundheitsbehörde (Ottawa Chart der Gesundheitsförderung 1986) als Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur Freisein von Krankheit und Gebrechen verstanden sowie als Grundrecht „ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen und sozialen Stellung“. Und in der 1997 verabschiedeten Jakarta-Deklaration zur Gesundheitsförderung im 21. Jahrhundert wird zusätzlich auf die Förderung sozialer Verantwortung für die Gesundheit verwiesen, die Festlegung und den Ausbau von Partnerschaften für die Gesundheit und die Stärkung der gesundheitlichen Potenziale von Gemeinschaften und der Handlungskompetenzen des Einzelnen. (Homepage des Österr. Gesundheitsministeriums[1], Hervorhebungen RAP)
In den fünf Jahren (2005–2009), in denen ich Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Fonds Gesundes Österreich war, gab es immer wieder Diskussionen, ob bei der Zuteilung der Fördermittel auf Projekte der schulischen, betrieblichen und kommunalen Gesundheitsförderung Schulen auch Betriebe wären. Ich vertrete die Ansicht, dass sie das sehr wohl sind – sie sind Arbeitsplätze. Und ich bin auch der Ansicht, dass Universitäten und Hochschulen in diese Perspektive einbezogen werden müssen.
Das Wort „Betrieb“ umfasst ja nicht nur das Betreiben von Zielen oder Prozessen sondern auch die juristische Umrahmung; hinterfragt man aber das Epistem dieser juristischen Grundlagen von mehr oder weniger großen bzw. komplexen Arbeitseinheiten nicht nur von der Gebotsseite sondern auch von der Verbotsseite, so treten neben die zivilrechtlichen Aspekte auch die strafrechtlichen[2], nämlich im Sinne der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers die Gesundheit die Mitarbeiterschaft (und seit der Novelle 2013 zum ArbeitnehmerInnenschutzgesetz auch die psychische!) nicht zu verletzen. Dem sollen Evaluationen dienen – aber was nützen Erhebungen zu gefühltem Stress wenn Fragen nach dem Führungsverhalten ausgeblendet werden?
Zwar können körperliche oder verbale Attacken gegenüber Vorgesetzten Grund für eine fristlose Entlassung bieten – umgekehrt müssen zivilrechtliche Sanktionen für gesundheitsschädigendes Verhalten erst mühsam arbeitsgerichtlich erstritten werden.
Der Freiburger Neurobiologieprofessor, Internist, Psychiater und Psychotherapeut Joachim Bauer betont, dass dauerhaft verweigerte Akzeptanz einen kritischen Abfall von gesund erhaltenden Botenstoffen und psychische und körperliche Erkrankung zur Folge haben kann. (Bauer: 41) „Die Schmerzgrenze wird ,aus der Sicht des Gehirns‘ keineswegs nur dann überschritten, wenn Menschen physischer, also körperlicher Schmerz zugefügt wird. Die Schmerzzentren des Gehirns reagieren auch dann, wenn Menschen sozial ausgegrenzt oder gedemütigt werden.“ (Bauer: 59)
Soziale Ausgrenzung beginnt bereits dann, wenn jemand aus der sozialen Gemeinschaft – beispielsweise einer Hörerschaft oder einem Team – negativ hervorgehoben wird und gleichzeitige Solidaritätsbekundungen verpönt werden. Sie liegt aber auch vor, wenn jemand aus selbstreferentiellen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen ist (ausgenommen Gefahr im Verzug). Bauer weist darauf hin, dass oft gerade Rücksichtlosigkeit – was als emotionale Störung klassifiziert werden kann – und manipulative Fähigkeiten Menschen in Führungspositionen aufsteigen lassen, wo sie durch ihren destruktiven Führungsstil großen Schaden anrichten. (Bauer: 93) Wenn man nun nicht das Verursacher- (Täter-)Paradigma anwendet sondern die Rahmenbedingungen betrachtet, die Kontrolle und Korrektur behindern, erkennt man die Analogiebildungen zu der übermächtigen Vater- oder Vatergott-Gewalt gegenüber unmündigen bzw. unmündig gehaltenen „Kindern“.
Was fördert – was hindert
Gewalt in umfassendem Sinn wird als Mittel sozialer Kontrolle von Abweichlern genutzt, die gegen geltende Normen verstoßen, zur Absicherung eines gefährdeten ökonomischen Status, zur Herstellung oder Stärkung der Identität z. B. bestimmter Altersgruppen, von Berufsgruppen usw., vor allem aber auch zur Erhaltung männlicher Hegemonie, und übt damit eine kulturelle Funktion aus. (Dinges: 188) Die physische Form ist als „elterliche Gewalt“ oder sexuelle Gewalt in der Ehe erst seit kurzem – etwa zwanzig Jahren – gesetzlich verboten; gegenwärtig entsteht das Bedürfnis nach Einschränkung verbaler Gewalt – aber nur in den sozialen Medien, da es dort massiv die Politikerschaft betrifft und damit öffentliche Bedeutung gewonnen hat. In der Arbeitswelt wird sie heruntergespielt. Finanzielle und vor allem strukturelle Gewalt wird hingegen weitgehend ignoriert und als persönliches Versagen der Benachteiligten individualisiert.
Unabhängig von mangelnder sozialer Kompetenz – oder auch Psychopathien in der Persönlichkeit (Bauer: 91 ff.) – der Akteure[3] zeigt sich strukturelle Gewalt in „traditionellen“, d. h. gewohnten „Spielregeln“ von Privilegien für Führende und gezielte Benachteiligung und Ausbeutung des “Nachwuchs“, Einschüchterungsverhalten und Ausgrenzung (Kündigung) von KritikerInnen sowie Versuchen zur Schaffung von (auch sexuellen) Abhängigkeiten.
Hinter diesen „Spielregeln“ verbergen sich langzeitlich erworbene epistemische Grundannahmen, wie soziale Ordnung herzustellen sei und was dabei gerecht ist. Neben geschlechts- bzw. generationendifferenzierenden Codes aus Medizin und Theologie finden sich dabei auch juristische Codes samt „Mechanismen der Durchsetzung“ (Baer: 159), die sich immer zwischen Bevormundung und Befreiung bewegen (Baer: 166).
Zu diesen Grundannahmen zählt auch das Ignorieren von physischem Stress und psychosexuellen Folgen sexueller Belästigungen. Noch immer wähnen manche Unbelehrbare, die ihre Rangattitüden ausagieren wollen, das Primaten-Vorrecht des ranghöchsten Männchens, mit jedem Weibchen zu kopulieren, gelte auch heute in Hierarchien. (Schwarz: 52 f.) Dass dies sexuelle bzw. sexualisierte Gewalt Mächtiger gegenüber wehrbehinderten Untergebenen darstellt, wird verleugnet, ins „neckische“ Gegenteil verkehrt oder im Vertauschungsagieren projiziert.[4] Gerhard Schwarz stellt fest, dass sexuelle Handlungen in dem Maß im Gegensatz zur Öffentlichkeit stehen und vermehrte Kontrolle verlangen, je mehr Menschen daran beteiligt sind. Er schreibt: „Das angemessene Benehmen jedes Partners ist Voraussetzung eines sozial organisierten Miteinander. Fassungslosigkeit oder Verlegenheit, Affekte und Emotionen disqualifizieren den Kulturmenschen in der Öffentlichkeit – es sei denn, er ist wie beim Schauspieler durch den Standard dazu legitimiert.“ (Schwarz: 125)
Hierarchien sind juristische – daher veränderbare – Konstruktionen zur Festlegung von Zuständigkeiten und Weisungs- bzw. Sanktionsrechten; sie sind keine Erlaubnis für schlechtes Benehmen oder Machtallüren. In einer auf egalitärer – im Sinn von gleichen Integritätsansprüchen – Kommunikation basierenden Zusammenarbeit sind räumliche wie zeitliche Grenzveränderungen in gewaltverzichtender Sprache zu vereinbaren, wobei Machtungleichgewichte a priori auf strukturelle Gewalt hindeuten.
Die Struktur des Wissenschaftsbetriebs
Von Robert Merton stammen die „vier institutionellen Imperative“, die das „Ethos der Wissenschaft“ ausmachen (Wiesner: 86 f.). Sie bestehen in
- Universalismus: Wahrheitsansprüche, gleich welcher Herkunft, müssen demnach vorab aufgestellten, unpersönlichen Kriterien unterworfen werden. Die Anerkennung wissenschaftlicher Behauptungen dürfe daher nicht von individuellen oder sozialen Merkmalen ihrer Verfechter abhängen.
- Kommunismus: Eigentumsrechte werden weitgehend beschnitten. Die Ansprüche von WissenschaftlerInnen auf ihr geistiges Eigentum beschränkten sich laut Merton auf Anerkennung und Ansehen – etwa durch Eponymie (Namensgebung nach den Entdeckenden).
- Uneigennützigkeit: Wenn die Institution uneigennütziges Handeln zur Pflicht erklärt, liegt es im Interesse der WissenschaftlerInnen, dieser Forderung zu entsprechen – als Rechenschaftspflicht gegenüber „Standesgenossen“ und damit spezifisches System institutioneller Kontrolle.
- Organisierter Skeptizismus: gefordert wird damit das methodologische und institutionelle Gebot von unvoreingenommener Prüfung von Ansichten und Überzeugungen anhand empirischer und logischer Maßstäbe.
Alle diese „Imperative“ können im Sinne des „organisierten Skeptizismus“ aber als Formen epistemischer Gewalt enttarnt werden:
Ad a) wird die Einstein‘sche Anschauung ignoriert, dass man Ereignisse nur am Beobachter beobachten kann (Devereux: 17) und auch der Wissenschaftler auf Grund seiner soziokulturell gelenkten Denkgewohnheiten unbewusst „willfährig“ den Forderungen der Gesellschaft entspricht, die von ihm auch erwartet, dass er diesen entspricht. (Devereux: 157) Es mutet daher grotesk an, wenn durch das Vermeiden von Ich-Sagen der Anschein von Objektivität erweckt werden soll – wie Frank Senske aufzeigt: „Beim Ich-Sagen gibt es wie bei jedem Sprechen von Irgendwas ein Ich-Sagendes, also ein Erkennendes und ein Be-Sagtes, also ein Erkanntes. Subjekt und Objekt. Ich-Erkennendes sagt „Ich“ zu einem Erkannten.“ (Senske: 32) Auch Heike Wiesner weiß, dass die Verbindung des Objektivitätsbegriffs mit Autonomiebestreben und die Erkenntnis, dass die Subjekt-Objekt-Trennung wohl mehr über das beobachtende Subjekt aussagt als über das beobachtete „Objekt“, nicht nur ungewohnt sondern vor allem unbequem ist – sie geht nämlich nicht ohne Selbsterkenntnis. (Wiesner: 55)
Je höher der beanspruchte Status von Wissenschaftlern (männlich!), desto eher wird Ich-Sagen akzeptiert. Je gewalt- und damit statusverzichtender Lehrende sind, desto mehr respektieren sie das Ich-Sagen als Form von Selbstachtung und auch Abwehr des wissenschaftlichen Kommunismus.
Ad b) ist festzustellen, dass Eigentumsrechte tatsächlich aber auch „gestohlen“ werden. Wie anders ist zu erklären, dass ein (juristisch ausgebildeter) Rektor (von dem man die Kenntnis von Urheberrechten erwarten sollte), während er anscheinend das geistige Eigentum von nicht seiner Universität zugehörigen Wissenschaftlern über (nicht akzeptable) Verträge erwerben will, gleichzeitig dieses an seiner Universität implementiert und noch dazu unter Vortäuschung einer real nicht erfolgten Einigung auch die zugehörigen Drittmittelfinanzierung? Und auf Protest zynisch erklärt „Ideen haben kein Mascherl?“ Redlichkeit sieht anders aus.
Wem gehört die Priorität auf Forschungsresultate?, fragt Heike Wiesner und berichtet, dass es ihr nicht gelungen sei, eine Vielzahl von Prioritätsansprüchen von Frauen ausfindig zu machen. (Wiesner: 89)
Ad c) wird Uneigennützigkeit insgeheim als Fremdnützlichkeit verstanden. Senske weiß: „Um im Wissenschaftsbetrieb, im Forschungslaboratorium des Profitkonzerns und der Ruhmuniversität arbeiten zu können, als lebendiger Mensch (nicht als Automat), muss man ganz ungeheuer viel ignorieren. Verdrängen, meine ich.“ (Senske: 50) Vor allem die Selbstachtung und damit den Anspruch auf psychische Unversehrtheit.
Merton etwa verweist auf die Unvereinbarkeit der Werte „Originalität“ – der Wissenschaftler motiviert, andere überflügeln zu wollen – und der geforderten „Bescheidenheit“. (Wiesner: 85) Prioritätsansprüche ließen sich als normativ-institutioneller Zwang für Frauen interpretieren, diese nicht einzufordern. Tun sie es doch, laufen sie Gefahr, diffamiert und ausgegrenzt zu werden. (Wiesner: 93)
Ad d) zeigen meine eigenen Erfahrungen mit Peer Reviews, dass die – anonym bleibende –Rezensentenschaft – offenbar in Ermangelung einer mir analogen Interdisziplinarität (als Juristin, Sozialtherapeutin, Pädagogin, Psychotherapeutin/ Psychoanalytikerin, Neurolinguistin und Theologin) – sich an meiner Sprachgestaltung „stößt“. Ich subsumiere meine Art zu schreiben / zu reden unter „Wissenschaftspoesie“. Statt sich mit dem Inhalt auseinander zu setzen, was Sicherheit in all diesen Sachgebieten (oder Unsicherheit zuzugeben) erfordern würde, wird meine Sprache kritisiert. Frank Senske schreibt: „ Wissen heißt: sich bestimmter Einfälle besonders sicher sein.“, und, „Ich bitte um Verständnis und Entschuldigung, wenn ich hier in einer scheinbar mechanistisch-objektivierenden Sprache spreche. Man muss sich leider eine ganz eigene Sprache erfinden, um diesen Fehler zu vermeiden, wie z. B. Martin Heidegger oder Alfred Whitehead.“ (Senske: 87)
Geheime Strategien: Cindarella-Taktiken
Wenn andere Menschen in ihrer Selbstaktualisierung behindert werden, liegt es nahe, von Wiederholungszwang (man tut anderen an, was einem selbst angetan wurde) zu sprechen. (Perner: 49 ff.) Doch liegt es öfter am Konformitätsdruck und Abwehr bedrohlicher Enttarnung eigener Karrieresehnsüchte. Wenn Paul Feyerabend über indigene Medizinmethoden schreibt: „Die Wissenschaften sind […] Produkte, die der Wissenschaftler zum Verkauf anbietet und die Bürger entscheiden, ihren Traditionen gemäß, was gekauft wird, und was man liegen lässt. Die Wissenschaften sind nicht Bedingungen der Rationalität, der Freiheit, sie sind nicht Voraussetzungen der Erziehung, sie sind Waren. Die Wissenschaftler aber selbst sind Verkäufer dieser Waren, sie sind nicht Richter über wahr und falsch. Sie sind höchstens bezahlte Diener der Gesellschaft, sie werden angestellt, um gewisse beschränkte Aufgaben zu lösen, und zwar unter Aufsicht der Bürger, die allein über die Natur der Aufgaben und die Art ihrer Ausführung entscheiden.“ (Feyerabend 1980: 17 f., Hervorhebungen im Original), entsteht so eine Vision einer demokratisierten Wissenschaft, die sich nicht nur auf „wissenschaftliche Berufsvorbereitung“ der Studierenden einlässt um Zeit und Raum für die eigene mehr oder weniger erfolgreiche Forscherkarriere zu erlangen oder abzudienen, sondern der Allgemeinheit verpflichtet ist, das geistige Potenzial ihrer Mitglieder optimal, d. h. ohne Beeinträchtigungen, zu fördern.
Die deutsche – im angloamerikanischen Sprachraum ist es anders! – Wissenschaftssprache ist dabei nur eine der Taktiken von hierarchischen Elitenbildungen; eine andere sind gezielte narzisstische Kränkungen für „Nicht-Gleiche“, die gleich werden wollen. Ist der Abstand groß genug, kann man den oder die Andere „über-sehen“, entsteht aber die Nähe der Konkurrenz, wird versucht, wieder Distanz zu produzieren. Eine andere Taktik ist die Bevorzugung (oder Diskriminierung) bei Abstammung aus den „richtigen“ Familien (oder Herkunft aus nützlichen Netzwerken), wie die EliteforscherInnen Julia Friederichs und Michael Hartmann nachweisen konnten.
Man erkenne, dass Vielfalt manchmal von außerwissenschaftlichen Instanzen erzwungen werden müsse, schreibt Paul Feyerabend, die genügend Macht hätten, um sich gegen die mächtigsten wissenschaftlichen Institutionen durchzusetzen. (Feyerabend 1986: 67) Das gleicht der Notwendigkeit von Staatskontrollen von gewalttätiger „Privatheit“ oder verteidigter „Autonomie“ beispielsweise der Universitäten. In einer „vaterlosen“ Gesellschaft verkümmert allerdings dieses Korrektiv.
Beispiele aus meiner Praxis
- Behinderungen: generelle externe Publikationsverbote, spezielle interne Publikationsverbote (z. B. bei gendersensiblen Themen) bzw. „sanfter“ Zwang, sich für die eigene Dissertation mit den Forschungsthemen des Vorgesetzten zu beschäftigen; Verweigerung von Unterschriften unter Ansuchen (z. B. für Habilitationsstipendien). Verbote, an Kongressen teilzunehmen.
- Ausbeutungen: „Vergessen“ von Namensnennung der Mitarbeitenden bei Publikationen, Vorschützen von Fällen „höherer Gewalt“ als Begründung der Nichtleistung ausgemachter Arbeitsteilung von Männern gegenüber gleichrangigen Kolleginnen, die ihre Arbeitsleistung konkret erbracht hatten und nun auch die Portion des Mannes abarbeiten, um Termine einzuhalten, aber bei der Präsentation des Werkes ausgeladen werden; „Umleitung“ von Drittmitteln, die niederrangige KollegInnen akquiriert hatten, auf sich selbst. Diebstahl von Konzepten zur eigenen Gloriole.
- Mobbing: Diskriminierung von Frauen bei der Vergabe von zulagenträchtigen Arbeitsaufgaben; Vorenthalten wesentlicher Informationen (z. B. über Termine von Teambesprechungen) an Frauen;
- Die Gefährdung der Existenz: wenn Zeitverträge auslaufen und nicht verlängert werden, weil der – aus dem Ausland stammende Professor – den Arbeitsplatz für seine Gattin benötigt.
Oder wenn kritische Personen trotz Zusage ihren Zeitvertrag nicht verlängert bekommen und sich die Wortbrüchigen winden, sie hätten ja loyal sein müssen – mit den Etablierten, gegen deren „Störenfried“.
- Demütigungen: Wenn ein (weitgehend unbekannter) Kunstprofessor Zeichnungen seiner Studentenschaft zerreißt, wenn sie ihm nicht gefallen, fügt er den StudentInnen (und der Kulturnation Österreich) nicht nur potenziellen finanziellen Schaden zu sondern attackiert die psychische Gesundheit. Sozial kompetent hingegen wäre, Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen und „Frühwerke“ zu respektieren.
Oder wenn eine Frau sich von der Schreibkraft zur Maturantin, Studentin, Promovierten, Habilitierten und international gesuchten Expertin entwickelt, nachdem ihr Zeitvertrag ausgelaufen ist, keine Verlängerung jedoch das Angebot erhält, wieder als Schreibkraft im Institut zu arbeiten.
- Bosheiten: in einer Universität wurde veranlasst, ein schweren Kasten im Gang so zu verschieben, dass der Zugang zum Damen-WC nicht mehr möglich war und die Studentinnen wie auch die damals einzige (!) Professorin den weiten Weg in die Gaststätte auf sich nehmen mussten.
- Elitenschutz: Zitat eines Rektors gegenüber einer Professorin: „Jemand aus der Lower Class kommt nie in die Upper Class“. Abwertungen von Personen, die in nichtwissenschaftlichen Qualitätsmedien publizieren als quasi Nestbeschmutzer.
- Es ist zu hoffen, dass frauenfeindliches Spotten in Lehrveranstaltungen der Vergangenheit angehört wie die ersten Sätze in der Vorlesung „Einführung in das juristische Denken“ (1962): „Ich sehe schon wieder so viele Damen! Meine Damen, was wollen Sie den hier? Wenn Sie ein Visitenkartendoktorat haben wollen, so studieren Sie doch Theaterwissenschaften – aber nehmen Sie doch Ihren Kommilitonen nicht die Plätze weg!“, oder in einem Seminar Ende der 1990er Jahre: „Meine Damen – setzen Sie sich in die letzte Bank, ich halte den Geruch von Menstruationsblut nicht aus!“
Forderungen
Gegen Gewalt hilft nur Öffentlichkeit:
Bereits in den späten 1980er Jahren hat sich ein Kreis innovativer WissenschaftlerInnen rund um die nachmalige Vizerektorin der Donau Universität Krems, seit 2009 Gründungspräsidentin der Berliner Universität für Weiterbildung und seit 2016 erste Rektorin der Fernuniversität Hagen, Ada Pellert kritisch mit den Organisationsformen von Wissenschaft und daher auch Universitäten auseinandergesetzt. Praktisch wie auch theoretisch ging es dabei um die Herstellung von Beziehungen zwischen Gesellschaft, Wissenschaft, Organisation und Lernen. (Pellert: 7) Dazu kritisiert Roland Fischer neben der Zersplitterung des Wissens vor allem die unbefriedigenden Entscheidungsstrukturen und das unterentwickelte Verhältnis der Universitäten zur Öffentlichkeit. (Fischer: 18 f.) Ich frage: welche Öffentlichkeit ist dabei gemeint? Interne oder externe? Nur eine positiv widerspiegelnde oder auch eine kritische, die Feudalstrukturen zu beseitigen verlangt?
Im Universitätsbetrieb zeigt sich noch immer das militärische Organisationsmodell, in dem eine Person viele befehligt, Schweigepflichten selbstverständlich erlebt werden und Widerspruch sanktioniert wird. Auch die klassische Organisationstheorie ignoriert den Menschen als Organisationsmitglied mit eigenen Zielsetzungen und eigenem Willen. (Pellert: 80) Das zeigt sich als klassisches Epistem struktureller Gewalt und betrifft Frauen noch mehr als Männer: dadurch dass wir alle zu Beginn unseres Lebens Weiblichkeit an unseren Müttern oder Mutterersatzpersonen wahrnehmen, liegt es nahe, die seinerzeitige stillschweigende Fürsorglichkeit immer und überall vorauszusetzen und Abweichungen als „Störung“ zu klassifizieren und beseitigen zu wollen um den ursprünglich vermeintlich paradiesischen Zustand wiederherzustellen.
Paradies: das bedeutet Einheit. Im Diesseits braucht es Einigung, d. h. Verzicht auf Informationsausschluss, Ausbeutung, Gewalt. Dazu dienlich wäre beispielsweise
- die ausdrückliche Verpflichtung und folglich Ausbildung von Führungskräften zur Gesundheitsförderung durch Vermeidung von Stresszufügung in Kommunikation und Strukturierung; stattdessen aktives Aufzeigen und unterstützendes Begleiten von Entwicklungsperspektiven, Zuerkennung und Nachweis von dazu dienlichen Handlungsspielräumen sowie Möglichkeiten von Einflussnahme.
- Dokumentation, Einsichtsrechte und Veröffentlichungspflichten bei nicht nur personellen sondern auch sozialen
- Regelmäßige öffentliche Rechenschaftsberichte samt Monitoring von Einrichtungen außerhalb des beobachten Systems und regelmäßiger Evaluation des Gesamtprozesses.
Dazu müssten sich Universitäten allerdings als „lernende Organisationen“ verstehen!
Literatur
Baer Susanne, Rechtswissenschaft. In: Braun v./ Stephan s. u.
Bauer Joachim, Schmerzgrenze. Vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt. Karl Blessing Verlag, München 2011.
Beckenkamp Martin, Wissenspsychologie. Zur Methodologie kognitionswissenschaftlicher Ansätze. Asanger, Heidelberg 1995.
Braun Christina von / Stephan Inge (Hg.), Gender Studien. Eine Einführung. J. B. Metzler, Stuttgart 2000.
Devereux Georges, Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften. Suhrkamp TB, Frankfurt / Main 1984/ 882.
Dinges Martin, Formenwandel der Gewalt in der Neuzeit. Zur Kritik der Zivilisationstheorie von Norbert Elias. In: Sieferle R. P. / Breuninger H. (Hg.) s. u.
Feyerabend Paul, Erkenntnis für freie Menschen. Veränderte Ausgabe, Suhrkamp TB, Frankfurt/ Main 1980.
Feyerabend Paul, Wider den Methodenzwang. Suhrkamp TB, Frankfurt/ Main 1986/ 19997.
Fischer Roland, Vernetzung und Widerspruch. Einführende Thesen zum Unternehmen. In: Pellert s. u.
Friedrichs Julia, Gestatten: Elite. Auf den Spuren der Mächtigen von morgen. Hoffmann und campe, Hamburg 20082.
Hartmann Michael, Der Mythos von den Leistungseliten. Spitzenkarrieren und soziale Herkunft In Wirtschaft, Politik, Justiz und Wissenschaft. Campus, Frankfurt / Main 2002.
Naidoo Jennie/ Wills Jane, Lehrbuch der Gesundheitsförderung. Herausgegeben von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln; Verlag für Gesundheitsförderung Gamburg 2003.
Pellert Ada (Hg.), Vernetzung und Widerspruch. Zur Neuorganisation von Wissenschaft. Profil, München Wien 1991.
Perner Rotraud A., Die Überwindung der Ich-Sucht. Sozialkompetenz und Salutogenese. Studienverlag, Innsbruck 2009.
Pilgrim Volker Elis, Dressur zum Bösen. Warum wir uns selber und andere kaputt machen. Rowohlt TB, Reinbek 1986.
Posern Thomas, Strukturelle Gewalt als Paradigma sozialethisch-theologischer Theoriebildung. Peter Lang, Frankfurt /Main 1992.
Schwarz Gerhard, Die „Heilige Ordnung“ der Männer. Patriarchalische Hierarchie und Gruppendynamik. Westdeutscher Verlag, Opladen 1985/ 872.
Senge Peter M., Die fünfte Disziplin. Klett Cotta, Stuttgart 1996/ 19997.
Senske Frank, Wissen schafft Wüste. Über Irrtum und Obsession der Natur-Verwissenschaftlichung. Asanger, Heidelberg 1995.
Sieferle Rolf Peter / Breuninger Helga (Hg.), Kulturen der Gewalt. Ritualisierung und Symbolisierung der Gewalt in der Geschichte. Campus, Frankfurt / Main 1998.
Sonntag Michael (Hg.), Von der Machbarkeit des Psychischen. Centaurus, Pfaffenweiler 1990.
Wiesner Heike, Die Inszenierung der Geschlechter in den Naturwissenschaften. Wissenschaft und Genderforschung im Dialog. Campus, Frankfurt / M. 2002.
Die Autorin
Rotraud A. Perner, JG 1944, Dr. iur., MTh (evang.), akadem. zertifizierte Erwachsenenbildnerin (PH Wien), lizensierte Psychotherapeutin / Psychoanalytikerin und Gesundheitspsychologin, Feldsupervisorin (ÖBVP), langjährige Universitätslektorin (dzt. Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien) und Gastprofessorin (Klagenfurt, Krems) mit Schwerpunkten Gewaltprävention, Gesundheitskommunikation, Sexualität, langjährige Gerichtssachverständige für Psychotherapie, seit 2016 Hochschulpfarrerin im Ehrenamt für alle niederösterreichischen Universitäten.
Umfangreiche „wissenschaftspoetische“ Fachpublizistik s. www.perner.info.
Fußnoten
[1] http://www.bmg.gv.at/home/Gesundheit_und_Gesundheitsfoerderung.
[2] Was viele nicht wissen (wollen), ist, dass dank der bildgebenden Methoden in der Gehirnforschung die Beeinträchtigungen von psychischer wie physischer Gewalt sichtbar und damit nachweisbar gemacht werden können. Man kann daher für die Zukunft Musterprozesse erwarten, in denen (ähnlich wie bei langandauernd zugefügten Schlafstörungen) Körperverletzung eingeklagt wird.
[3] Wobei zu hinterfragen wäre, ob Psychopathen in Führungspositionen drängen, um nicht mit ihrer mangelnden Sozialkompetenz konfrontiert zu werden – oder ob umgekehrt die Strukturen die Entwicklung von Psychopathien (z. B. aus Angst vor Enttarnung fachlicher wie auch sozialer Unzulänglichkeiten) fördern.
[4] So wurde 2016 der Rektor des Salzburger Mozarteums von einem Münchner Schöffengericht zu einem Jahr und drei Monaten bedingter Haft wegen sexueller Nötigung verurteilt. (Salzburger Nachrichten, 14. Mai 2016, S. 10)